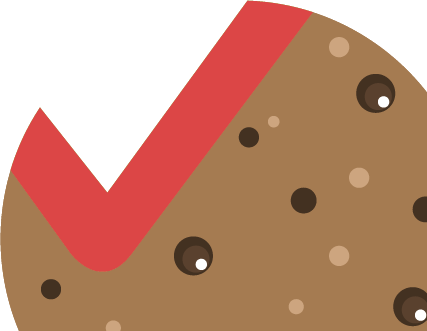Städte entwerfen
Wie stellst du dir das Graz deiner Zukunft vor?
Städte verdichten nicht nur Menschen, sondern auch deren Hoffnungen und Ängste. So erscheint das Stadtleben als Synonym für Wohlstand, Abenteuer und erfüllte Träume; doch steht es auch für Einsamkeit und Entwurzelung. Städte faszinieren und verstören, ziehen Menschen magisch in ihr Zentrum und stoßen sie wieder in die Peripherie. Sie gelten als Pulsgeber unserer Zeit, als Projektionsflächen utopischer wie auch dystopischer Zukünfte. Neu ist das Gewand der „Smart Cities“. Es wird traditionsreichen Städten wie Wien und Graz übergeworfen, aber auch zur Richtlinie neuer vom Reißbrett entworfener Metropolen weltweit. Vor Kurzem erst hat Saudi-Arabien mit seiner Planstadt „Neom“ für Aufsehen gesorgt. Smarte Städte – auch als Smart Urbanism, clevere Urbanisierung, bezeichnet – sind keine Zukunftsmusik. Die globale Transformation der Städteplanung unter der Maßgabe verdichteter Datenströme ist in vollem Gange.
Städte verdichten nicht nur Daten, sie sind zu regelrechten Datenfeldern geworden. Wirtschaftsunternehmen, Kommunen sowie Bürger*innen ringen um die digitale Aussaat. Denn auch auf Datenfeldern gilt: „Du erntest, was du säst.“ Das Dilemma dabei: Unsere großen und kleinen Metropolen sind bereits digital geworden. Wer schon bei der Landnahme der vergangenen Jahre ganz vorne mit dabei war, hat heute natürlich bei der Gestaltung smarter Städte ein Wörtchen mitzureden. Es sei zum Beispiel an marktbeherrschende Unternehmen wie Google, Microsoft oder Oracle gedacht. Das führt zu Interessenkonflikten zwischen Kommunen – die ja im öffentlichen Interesse handeln sollen –, privatwirtschaftlichen digitalen Dienstleistern – die längst schon die Datenströme städtischen Lebens als Ölquelle erschlossen haben – sowie Bürger*innen die bei der Gestaltung ihrer Lebensräume demokratisch mitentscheiden wollen. Wir stecken schon mitten drin in der technologischen Verdichtung und politischen Verhandlung urbaner Datenräume. In der Ausstellung Die Stadt als Datenfeld wird dazu eingeladen, die oft abstrakten, (post)digitalen Fragestellungen in ihrer Vielfalt sinnlich-konkret zu erleben. Sie fordert dazu auf, ein kritisches Verständnis smarter Städte zu entwickeln und aus einer Kritik der Gegenwart heraus konstruktive Utopien für die Zukunft zu wagen.
Stadtwelt @Datenfeld
Wagen wir eine eigene urbane Utopie aus einer demokratischen Kritik der Gegenwart heraus? Im Zentrum unserer Städte stehen zwischenmenschliche Beziehungen, die durch Relationsnetze gestaltet sind. Dieses Bild malt Vilém Flusser im zweiten Kapitel – „Städte entwerfen“ – seines technikkritischen Buchs Vom Subjekt zum Projekt. Die Ausstellung „Die Stadt als Datenfeld“ greift dieses Motiv bildlich auf. Smart Cities werden als soziale Relationsfelder thematisiert, in denen sich gesellschaftliches Leben, aber auch Datenströme verdichten. Eine andere Metapher ist die der „Masken“. Flusser bezeichnet damit die sozialen Identitäten, die Rollen und Funktionen, die wir annehmen und ausüben. Anhand der Bilder des „Beziehungsnetzes“ sowie der „Masken“ tauchen die Besucher*innen in Flussers Welt ein und entdecken neue Perspektiven, ihre eigene Stadt weiterzudenken.
Bisher waren Städte Werkzeuge zur Identifikation ihrer Bewohner. Flusser illustriert sie als Fabriken für Masken, also soziale Rollen und Identitäten. Doch das ändert sich nun mit Smart Cities. Nicht alle Masken passen mehr, andere verselbstständigen sich. Berufe vergehen und entstehen neu. Wie Flusser sagt: Es sind die Masken, die „tanzen“. Städte sind zu global vernetzten Räumen geworden. Entsprechend großflächiger werden auch die Masken, die wir uns in global vernetzten Beziehungsräumen aufsetzen. Flussers Gedanke des kulturellen Lebens als Schaltplan, die Regierung der Polis durch Technik ist allgegenwärtig. Gibt es eine wesentliche Kritik am Diskurs? Vielleicht ist es eine demokratische: Wie kommen die sozialen Welten, die Beziehungsnetze und Masken, überhaupt in die Tabellen, mit denen in unseren Städten gerechnet wird?
Was ist die heiße Debatte?
Digitalisierung ist längst im „postdigitalen“ Zeitalter aufgegangen. Der Diskurs über Postdigitalität wurde von Nicholas Negroponte 1998 durch eine Kolumne im -Magazin Wired angeregt. Digitalisierung erkennen wir demnach nur noch durch ihre Abwesenheit. Sie ist da und kommt nicht mehr auf uns zu. Daraus ergibt sich eine Veränderung der Perspektive, die auch den Diskurs um Smart Cities prägt: Die Frage „Wollen wir unsere Stadt vernetzen?“ wird abgelöst von der Frage „Wie navigieren wir mit Daten in unserer längst schon vernetzten Stadt?“.
Global scheint ein regelrechter Wettstreit um die „smarteste Stadt“ der Zukunft entbrannt zu sein. Hierbei punktet zum Beispiel Barcelona mit partizipativen Konzepten der Bürgerbeteiligung oder Oslo mit einer Mischung aus postmoderner Architektur und Umweltschutz. Smart Cities werden dem postdigitalen Ansatz entsprechend nicht mit Digitalisierung beworben, sondern mit effizienten Problemlösungen der Mobilität oder der Energieversorgung, ökologischen Konzepten und Lebensqualität. Daraus speisen sich sowohl utopische Hoffnungen als auch dystopische Ängste, die kontrovers diskutiert werden. Vier Beispiele illustrieren den postdigitalen Diskurs anschaulich: The Line und Neom City in Saudi-Arabien, Graz – Die digitale Agenda, Paris – Die 15-Minuten-Stadt, Barcelona – Smart City 3.0.
Utopischer Pool: Hoffnung wagen
1516 identifiziert Thomas Morus in seinem Roman Utopia Städte als treibende Kräfte sozialen Fortschritts. Die Idee einer besseren Gesellschaft durch bessere Urbanisierung reicht kulturell weit zurück. Auch heute begegnet sie uns in den Erwartungen, die sich an Smart Cities knüpfen. Seit 2007 bewirbt besonders IBM das Konzept der Smart Cities und knüpft daran Ideen effizienter technischer Lösungen zum Allgemeinwohl. Die postdigitale Kontroverse offenbart auf der einen Seite die Suche nach einer neuen Gesamtutopie. Künstliche Intelligenz erscheint als Heilsbringer der Stadtplanung, als universale Problemlösung. Die Welt verdichtet sich in einem Netz datafizierter Kommunen, ökologisch vorbildlich, inklusiv, effizient, glücklich …
Dystopischer Pool: Ängste schüren
Den Erlösungsfantasien utopischer Smart-City-Konzepte stellt Anthony Townsend in Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia die Sorge vor einer leeren Hülle enttäuschter Hoffnungen gegenüber. So wurde auch die Smart-City-Kampagne von IBM seit 2007 immer wieder kritisch gesehen und als eine industrieorientierte Verengung des Blicks entlarvt. Wo bleiben Bürgerbeteiligung und demokratische Aushandlungsprozesse, vor allem das Lokalkolorit, wenn die (post)digitale Agenda der eigenen Stadt von einem weltweit agierenden Unternehmen vorgegeben wird? Droht nicht ein technokratischer Kollaps – die Erosion gesellschaftsorientierter Problemlösungen durch technikgläubig gemachte Politik? Wer hoch steigt, kann auch tief fallen …
Wie würdest du entscheiden?
Hältst du Barcelona für ein Vorbild, weil hier Entscheidungen „von oben“ mit Konzepten der partizipativen Bürgerbeteiligung „von unten“ kombiniert werden? Oder sollten Bürger im Sinne direkter Demokratie auch direkten Einfluss auf die Gestaltung von Smart Cities ausüben? Ist Saudi-Arabien mit Neom und The Line ein Erfolg versprechendes Vorbild? Sollten Smart Cities also besser von Grund auf neu geplant werden? Wie sieht es in Österreich aus, welchen Einfluss nimmst du auf die Gestaltung deiner Stadt? Wie wollen wir Städte entwerfen?
The Line und Neom City in Saudi-Arabien
Mit einer spektakulären Vision wirbt Saudi-Arabien seit Jänner 2021 öffentlichkeitswirksam um Prestige und ausländische Investoren. „The Line“ bezeichnet eine 170 Kilometer lange, sogenannte „Bandstadt“, die sich kerzengerade von der Küste des Roten Meeres aus durch Wüsten und Berge zieht. In der 500 Milliarden Dollar teuren Vision reiht sich eine Siedlung an die nächste – wie bei einer Perlenkette. Die ganze Stadt soll von Grund auf mittels künstlicher Intelligenz geplant werden sowie ein gigantisches Netzwerk smarter Systeme umfassen. Autos, wie wir sie kennen?
Fehlanzeige! Binnen fünf Minuten ist alles Notwendige zu Fuß erreichbar, größere Strecken werden unterirdisch in autonomen U-Bahnen zurückgelegt. Hier sollen bald mehr Roboter als Menschen leben. Auf den 25. Oktober 2017 datiert die weltweit erste Einbürgerung eines androiden/gynoiden Roboters. Die Maschine heißt Sophia und verfügt seitdem über einen saudi-arabischen Pass.
„The Line“ ist als Teil von Neom City gedacht, einer urbanen Region im Nordwesten des Landes. Wie bei einem PC lassen sich ganze Stadtteile, Technologieparks oder unterirdische Transportwege per „Plug and Play“ hinzufügen. Die versprochene „Revolution“ soll umweltfreundlich sein, nur Wind- und Sonnenenergie sollen zum Einsatz kommen. Doch handelt es sich dabei nicht eher um einen Marketingbluff? Sowohl die Umsetzbarkeit eines solchen Projekts als auch dessen geopolitische Strategie – eine smarte Planstadt an der Grenze zu Ägypten und Jordanien – wird kontrovers diskutiert.
Beispiel: Graz
Die digitale Agenda
Wie divers das Label „Smart City“ gebraucht wird, zeigt auch die Außendarstellung der Stadt Graz. Hier stehen vor allem die Werte der Lebensqualität sowie der nachhaltigen Energieversorgung im Mittelpunkt. Diesen Normen folgend, wird auch der Begriff „Smart City“ als „energieeffiziente, ressourcenschonende und emissionsarme Stadt höchster Lebensqualität“ definiert. Digitalisierung oder eine postdigitale Verhandlung des Umgangs mit Datenfeldern steht nicht im Mittelpunkt. In der offiziellen Agenda wird eine entsprechende Transformation bis zum Jahr 2050 beworben.
Hinzu treten digitale Serviceleistungen des E-Government – also Behördengänge mit Computer von zu Hause aus –, die jedoch nicht mit Graz als „Smart City“ identifiziert sind. Utopien nachhaltiger Energieversorgung, Versprechen „höchster Lebensqualität“ und E-Government – das sind administrative Planspiele. Aber was ist mit gelebter Demokratie und realer Bürgerbeteiligung?
Beispiel: Paris und Wien
Die 15-Minuten-Städte
Ein anderes aktuelles Konzept wird als „15-Minuten-Stadt“ bezeichnet. Anstatt umfassende Mobilität in einer ganzen Metropole zu etablieren, sollen die Bewegungsradien ihrer Bewohner*innen konstruktiv verkürzt werden. Was nicht in 15 Minuten zu Fuß oder per Rad erreicht werden kann, das brauche ich auch nicht für meinen Alltag – so das Motto. Einkaufen, Schule, Arbeit – all das soll in der Nachbarschaft direkt verfügbar sein.
Paris gilt als eine Vorreiterin bei der Umgestaltung ihrer Altstadt nach diesem Konzept. Aber auch die Seestadt Aspern in Wien ist von dieser Idee inspiriert. Automobilität und Umweltbelastungen sollen auf diese Weise ebenso reduziert werden wie zeitintensive Verkehrsstaus. In Zeiten der Corona-Pandemie und des Homeoffice üben aktuell viele von uns bereits für diesen Lebensstil. Eine Folge für das Konzept der Stadt ist, dass ihre Grenzen zum Umland mehr als vorher verschwimmen. Sie wird zu einer Wabenstruktur ungezählter 15-Minuten-Segmente, die auf dem Konzept einer postdigitalen Stadt fußend ein Netzwerk um den ganzen Globus bilden können.
Beispiel: Barcelona
Smart City 3.0
Smart City 3.0
Als einer der populärsten urbanen Räume gilt Barcelona. In ihr verbindet sich eine gotische Altstadt mit diversen neueren Architekturepochen bis hin zu einer „Smart City 3.0“. Sie bildet also ein historisch gewachsenes Gegenmodell zur saudi-arabischen Neom City. Unter Smart City 1.0 wird dabei ein Top-down-Ansatz verstanden.
Stadtentwicklung erfolgt also auf kommunaler Ebene und wird politisch entschieden. Bottom-up erfolgt hingegen Urbanisierung, die direkt von den Bürger*innen ausgeht. Hierfür hat sich, in Anlehnung an die Zählweisen von Industrie 1.0 bis 4.0, der Begriff „Smart City 2.0“ etabliert. Barcelona erscheint nun als ein Kompromiss aus beiden Ansätzen. Sowohl politische Entscheidungen „von oben“ als auch intensive Bürgerbeteiligungen „von unten“ verbinden sich zu einem populären Modell des Smart Urbanism.